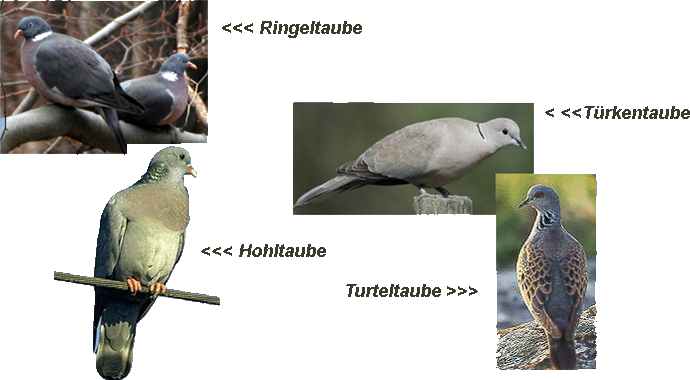Ringeltaube, oder der "Hahn des kleinen Mannes".
- Ringeltauben gehören zu den meist gehassten und am wenigsten beliebten Vögeln unserer Fauna.
-
- Eine Menge Gründe gibt es dafür:
-
- So plündern Ringeltauben allzu gern die frischen Saaten in unseren Gärten und auf den Feldern,
- so laben sie sich im Frühjahr an den Knospen der Obstbäume und
- fallen mit ungeheurer Dreistigkeit über unsere schönsten Kirschen her und
- sorgen darüber hinaus mit ihrer gesunden Verdauung noch dafür, dass wir uns über ihre unappetitlichen Hinterlassenschaften auf Terrassen und Wegen ärgern müssen.<
-
- Wirklich kein Wunder, dass sich nirgendwo Mitleid regt, wenn eifrig Jagd auf sie veranstaltet wird und ihre Schonzeit auf ein Minimum reduziert wird.
-
- Doch mag die Jagdstrecke auch noch so hoch sein, sämtliche Jäger werden es nicht schaffen, den Bestand der Ringeltauben zu regulieren oder gar zu gefährden.
-
- Das schaffen auch die natürlichen Fressfeinde nicht.
-
- Die meisten Verluste entstehen durch Rabenvögel, die es vor allem auf die Eier der Taube abgesehen haben, die anderen Fressfeinde wie
-
- Waldkauz,
- Habicht,
- Eichhörnchen,
- Mauswiesel,
- Hauskatze und
- Wanderratte
- erlangen selten eine größere Bedeutung.
-
- Wie kaum eine andere Vogelart hat es die Ringeltaube verstanden, sich dem Lebensraum Stadt anzupassen.
-
- Sie wurde in den letzten Jahrzehnten zu einem extremen Kulturfolger.
-
- Wenige Reisigzweige reichen ihr, um ihr kunstloses Nest in einer Astgabel anzulegen, wenn sich bloß ein Baum findet.
-
- Findet sich keiner, so wird zur Not auch mal an Gebäuden gebrütet oder im Wein oder Efeu, der an den Wänden hochrankt.
-
- Während Ringeltauben in unseren Wäldern und in der Parklandschaft in der Regel nur zweimal brüten, können sie in der Stadt und in unmittelbarer Nähe des Menschen weitaus häufiger brüten.
-
- Ihre Ansprüche an den Lebensraum sind ausgesprochen gering.
-
- Sie benötigen neben Flächen mit niedriger oder lückenhafter Vegetation für den Nahungserwerb vor allem größere Holzpflanzen als Nist- und Ruheplätze.
-
- Im Siedlungsbereich des Menschen finden sie das ganze Jahr hindurch genügend Nahrung und so sind Bruten schon im Februar und noch im November in unseren Städten und Dörfern keine Seltenheit mehr.
-
- Das Gelege besteht aus zwei Eiern,
- die Jungen schlüpfen nach 16-17 Tagen und bleiben gut vier Wochen im Nest.
- Mit 35 Tagen sind die Jungtauben voll flugfähig.
- Die Ringeltauben sind fast reine Vegetarier, die neben
-
- Früchten und
- Samen,
- Keimpflanzen und
- grünen Blättern vom Klee und Gemüsekohl,
- besonders gern Getreidekörner
- und Rapssamen
- zu sich nehmen.
-
- Im Unterschied zu den anderen Taubenarten gelangen Ringeltauben auch in Bäumen und Sträuchern zu ihrer Nahrung.
-
- So werden Eicheln, Bucheckern und sogar Kirschen unzerteilt geschluckt.
-
- Der Nahrungsbedarf einer Ringeltaube liegt bei rund 50 Gramm am Tag.
-
- Unvoreingenommen betrachtet sind Ringeltauben eigentlich attraktive Vögel.
-
- Der ringelförmige weiße Halsfleck, nach dem die Taube benannt ist, ist von grün und purpurn schillernden Federn eingesäumt.
-
- Das Gefieder leuchtet blaugrau, beim geräuschvollen Auffliegen wird ein weißes Flügelband sichtbar.
-
- Schon durch die Größe von rund 40 cm unterscheiden sich Ringeltauben von den anderen heimischen kleineren Taubenarten.
-
- Sehenswert ist der Balzflug dieser Taube mit der kurzen Aufstiegsphase, dem Flügelklatschen und der mit halbgeschlossenen Flügeln schräg hinabführenden Gleitstrecke.
-
- Das tiefe, etwas raue Gurren der Taube gehört zu den bekanntesten Lautäußerungen von Vögeln und trotz allen Ärgers mit dem Vogel wird darauf im Frühjahr wohl niemand ernsthaft verzichten mögen.
-
|