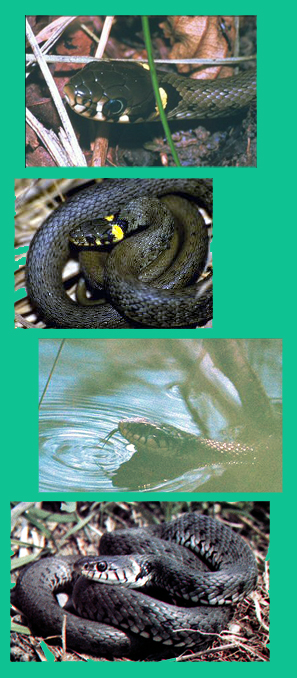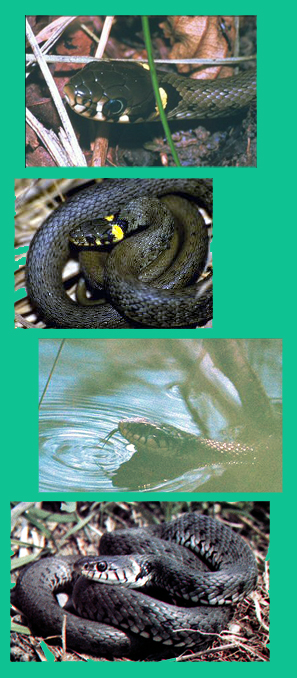
|
Tiersteckbrief:
- Die Ringelnatter ist die häufigste Schlange Mittel- und Südeuropas.
- Sie kommt in ganz Europa mit Ausnahme von Island, Irland und dem Hohen Norden vor.
Südostlich liegt ihre Verbreitungsgrenze im Nordiran, und ostwärts am Baikalsee.
- Ringelnattern sind ungiftige, tagaktive Schlangen.
- Bei ihnen handelt es sich um große, kräftige Wassernattern.
- Der Kopf ist vom Hals deutlich abgesetzt und relativ gross und hoch.
- Das Auge besizt eine runde Pupille.
- Die Rückenschuppen in 19 Längsreihen angeordnet, sind stark gekielt.
- Die Kopfoberseite wird von 9 großen glänzenden Schildern bedeckt.
- 163 bis 183 Bauchschilder, ein geteiltes Afterschild und 53 bis 78 paarige
Unterschwanzschilder bedecken die Körperunterseite.
- Die Weibchen unterscheiden sich in Länge und Größe von den Männchen, wobei diese deutlich
länger und von massigerem Körperbau sind als die letzteren.
- Ihre Körperfarbe ist schiefergrau, grün- oder olivgrau.
- Daneben tritt aber auch Melanismus auf, d.h,. ganz oder teilweise schwarz gefärbte Tiere.
- Am Hinterkopf ist bei den meisten Unterarten eine gelbe, weiße oder orangerote,
halbmondförmige Zeichnung ("Halbmondfleck") sichtbar.
|