2
3
4
5
6
7
9
10
11, 12
13
Antennenschaft
zweites Antennenglied
Komplexaugen
Stirn
Kopfschild
Unterkiefer
Kiefertaster
Oberlippe
Teile des Kiefers
Lippentaster

Die Welt der Insekten
Vom Körperbau der Insekten
|
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11, 12 13 |
Scheitel Antennenschaft zweites Antennenglied Komplexaugen Stirn Kopfschild Unterkiefer Kiefertaster Oberlippe Teile des Kiefers Lippentaster |

|
Die Brust
Der Hinterleib
Die Fühler
|
Der Rest der Antennen besteht aus der Geissel, die bei den primitiven
Insekten sehr lang und dünn ist und aus einer grossen Anzahl sich allmählich verkleinernden
Gliedern besteht (a). Diesen Grundtyp langer Geisselantennen finden wir z.B. bei den Uferfliegen, Schaben, Heuschrecken und vielen anderen Gruppen. Die Antennen sind in der Regel aber verschieden ausgebildet, manchmal tragen die Glieder der Geissel verschiedene Haare oder Borsten (b) oder lange ein- bis zweireihige kammartige Fühlerfortsätze (c), die Geissel kann aber auch nur borstenförmig und ungegliedert sein. Die Anzahl und Form der Antennenglieder sind immer wichtige Bestimmungsmerkmale. |
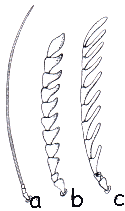
|
Die Flügel

|
Im Grundschema unterscheiden wir vom vorderen (kostalen) Flügelrand beginnend folgende Adern:
|
Die Mundwerkzeuge
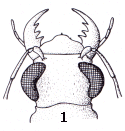
|

|
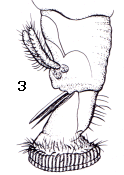
|
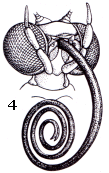
|
| Der Ausgangstyp ist ein Beissapparat (1), dessen Grundlage dem Beissen dienende Oberkiefer sind. |
|
|
|
Das Insektenbein

|
Das Insektenbein setzt sich aus fünf Gliedern zusammen:
|